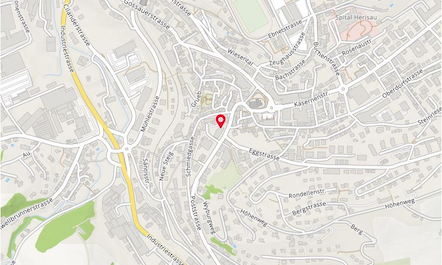Gemeinsam für ein würdevolles Leben
Nicht alle Menschen bewegen sich auf der sonnigen Seite des Lebens. Die Gründe dafür sind vielfältig und reichen von körperlichen über psychische bis zu geistigen Gebrechen. Nicht selten leben diese Personen am Rand der Gesellschaft und sind auf Hilfe angewiesen. «Wenn die Kindes- und Erwachsenenschutzbehörde (KESB) zum Schluss kommt, dass eine Person schutzbedürftig ist und Unterstützung benötigt, kann sie Massnahmen erlassen. Unsere Aufgabe ist es, diese errichteten Schutzmassnahmen im Alltag umzusetzen», erklärt Lukas Kradolfer, stellvertretender Bereichsleiter der Regionalen Berufsbeistandschaft Hinterland (RBH). «Wir werden oft mit der KESB gleichgesetzt, aber diese agiert kantonal und fällt die Grundsatzentscheidungen, welche Schutzmassnahmen notwendig sind.» Abhängig von den notwendigen Kenntnissen werde die Schutzmassnahme dann von einem Berufsbeistand oder von einer privaten Beistandsperson geführt. «Wenn beispielsweise jemand einen Angehörigen mit einer Beeinträchtigung hat, stellt sich oft ein Familienmitglied als Beistand zur Verfügung», so Monika Akbarzada, zuständig für die Beratung der privaten Beistandspersonen. «Die KESB prüft diese Person im Vorfeld und ernennt sie bei einer entsprechenden Eignung zum Beistand.»
Rund 100 Beistandspersonen
Doch nicht immer findet sich eine Beistandsperson aus dem nahestehenden Umfeld einer Person. Bei solchen Mandaten ist die RBH auf sogenannte rekrutierte private Beistandspersonen angewiesen. «Wir haben ein Tool, in dem sich etwa hundert private Beistandspersonen befinden. Rund zwei Drittel davon sind nahestehende private Personen mit familiärem Bezug zur verbeiständeten Person, ein Drittel sind Rekrutierte. Diese setzen sich freiwillig für schutzbedürftige Personen ein, zu denen sie keinerlei private oder familiäre Verbindung haben», erklärt Monika Akbarzada. Früher hätten die Behörden das Recht gehabt, diese Beistände zu ernennen.
«Das waren angesehene Persönlichkeiten im Dorf wie beispielsweise Lehrpersonen, denen man das notwendige Vertrauen für diese Aufgaben entgegenbrachte.» In den vergangenen Jahrzehnten habe jedoch ein Umdenken stattgefunden, die Berufsbeistandschaft wurde professionalisiert. «Trotzdem sind wir nach wie vor auf private Beistände angewiesen, die sich sagen: Ich würde gerne mein Können und meine Zeit für Menschen investieren, die meine Unterstützung brauchen.»
«Ich fand Freude daran, jemandem zu helfen»
Jürg Schwarber ist eine der rekrutierten privaten Beistandspersonen, die Beistandschaften ohne familiären Bezug führen. Er wurde noch von der damaligen Vormundschaftsbehörde zur Übernahme von Beistandschaften verpflichtet, hat aber schnell die schönen Seiten der Tätigkeit erkannt: «Ich musste ein Mandat übernehmen und fand Freude daran, jemandem zu helfen. Als meine Tätigkeit dann beendet war, habe ich sogleich das nächste Mandat angenommen.»
Viele seiner Klientinnen und Klienten hätten eine Beeinträchtigung und seien deshalb in ihren Kompetenzen eingeschränkt. Seine Aufgaben seien vielfältig, sie reichten von der Regelung der Finanzen über Korrespondenzen bis zur Suche eines Arbeitsplatzes. «Gerade die Buchhaltung klingt nach viel Aufwand, aber diesen schätze ich auf eine halbe Stunde in der Woche», so Schwarber. «Die Einnahmeseite ist durch IV-Renten und Ergänzungsleistungen vorgegeben, dasselbe gilt für die Ausgaben. Vor allem bei Menschen, die im Heim leben, ist die Buchhaltung keine grosse Sache.»
Die Menschen befähigen – etwa einen Bus zu nehmen
Neben den «nüchternen» Aufgaben wie die Ausführung von Zahlungen oder die Buchhaltung schätzt Jürg Schwarber den persönlichen Kontakt. Im ersten Moment halte sich die Begeisterung bei vielen Klientinnen und Klienten in Grenzen, wenn ihnen ein Beistand vorgesetzt werde. «Aber ich versuche, ihnen die Chancen der Situation aufzuzeigen. Ich will ihnen nichts wegnehmen, sondern sie entlasten. Wenn sie sich nicht um diese Pflichten kümmern müssen, bleibt ihnen mehr Zeit für Dinge, die sie gerne machen.» Oftmals hätten die schutzbedürftigen Personen kaum soziale Kontakte. Viele seien froh, jemanden zum Reden zu haben. «Sie sind von der Gesellschaft und ihrem privaten Umfeld abgeschnitten. Deshalb schätzen sie es sehr, wenn ich sie besuche. Und auch mir bereitet das eine grosse Freude.»
Mit seinem Engagement will Jürg Schwarber dazu beitragen, die Würde der Menschen zu bewahren. Diese gehe oft verloren, wenn jemand aufgrund einer Beeinträchtigung von der sozialen Teilhabe ausgeschlossen werde. «Zu einem würdevollen Leben gehören aber auch soziale Kontakte, deshalb liegt mir das am Herzen.» Schwarber nennt sogleich einen weiteren Grund, der für eine persönliche Beziehung spricht: «Wenn das gegenseitige Vertrauen da ist, kann ich meine Klientin oder meinen Klienten befähigen und ihnen einen Teil ihrer Selbstständigkeit und Würde zurückgeben.» Als Beispiel nennt er den Arbeitsweg zu einer sozialen Einrichtung oder den Besuch einer externen Therapie. «Natürliche fahre ich meine Klientin oder meinen Klienten am ersten Tag hin – und wenn es sein muss auch an den Folgetagen. Aber wenn sie irgendwann eigenständig den Bus nehmen können, haben sie eine riesige Freude. Diese Selbstständigkeit und Selbstbestimmung sind für mich zentrale Anliegen.»
Coachings und Austausch
Dass die schutzbedürftigen Personen mit der passenden Beistandsperson zusammenkommen, liegt in der Verantwortung von Monika Akbarzada. «Mit der Zeit bekommt man ein Gefühl dafür, welche Beistandsperson zu welchem Mandat passen könnte.» Die rekrutierten privaten Beistandspersonen können bei der Anmeldung angeben, in welchen Bereichen sie entsprechende Kompetenzen haben. «Einige nehmen sich ausschliesslich der finanziellen Angelegenheiten an. Andere wie Herr Schwarber sind bereit, einen stärkeren persönlichen Kontakt einzugehen.» Wenn eine passende Beistandsperson gefunden wurde, wird diese angefragt und bei Interesse ein erstes Treffen mit der Klientin oder dem Klienten vereinbart. «Dort bin ich ebenfalls anwesend und moderiere das Erstgespräch», so Monika Akbarzada, die sich um die Unterstützung, Beratung und Begleitung der privaten Beistandspersonen kümmert. Neben einer individuellen Einführung in das Mandat auf Wunsch ist sie auch für das Coaching während eines laufenden Mandats zuständig, organisiert Weiterbildungen und bietet neu für interessierte Beistandspersonen einen Erfahrungsaustausch an.
Jürg Schwarber schätzt diese Möglichkeiten, obwohl er mittlerweile ausreichend Erfahrung mitbringt, die Mandate in Eigenregie zu führen. «Wovon ich jedoch profitiere, ist der Austausch mit anderen Beistandspersonen. Da kann ich vieles mitnehmen, weil sie von ihren Erfahrungen und Sichtweisen erzählen.» Für ihren Aufwand werden die privaten Beistandspersonen finanziell entschädigt. Dafür müssen sie grundsätzlich alle zwei Jahre einen Bericht bei der KESB einreichen. Dieser wird von der Behörde geprüft, die anschliessend über die Höhe der Entschädigung entscheidet. Jürg Schwarber sagt, dass die Einnahmen für Ferien reichen. «Aber ich übernehme keine Beistandschaft aus finanziellen Interessen. Mir geht es darum, gemeinsam mit einem Menschen, der meine Hilfe benötigt, zu schauen: Wie können wir gemeinsam einen Weg zu einem möglichst selbstbestimmten Leben finden?»
Zugehörige Objekte
| Name | |||
|---|---|---|---|
| Unsere Gemeinde August 2025 (PDF, 3.06 MB) | Download | 0 | Unsere Gemeinde August 2025 |